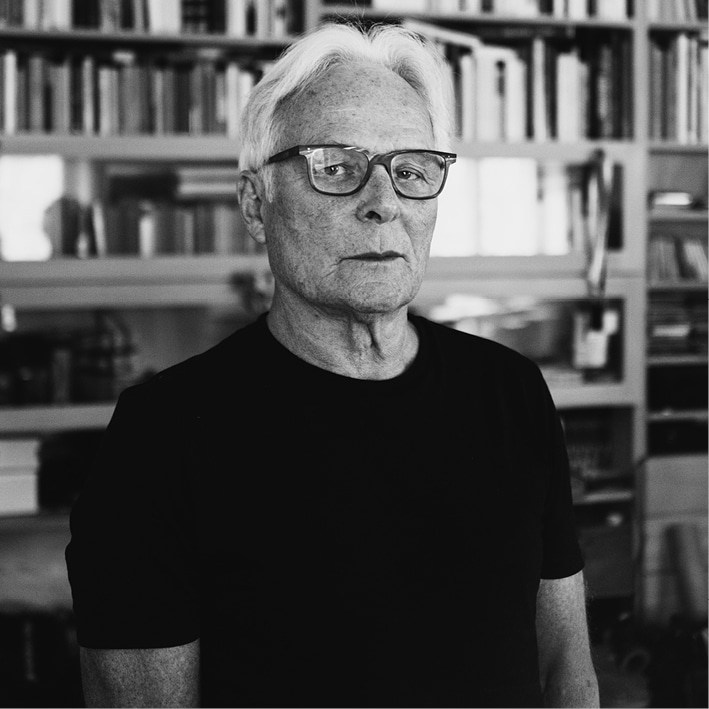Existentielles Zusehen
Ein Ziegenkopf in Großaufnahme, das Tier blickt uns an und wendet dann den Kopf zur Seite, die Herdenmarke am Ohr wird sichtbar. Ziegen werden gefüttert; weidende Ziegen bimmeln mit ihren Glöckchen, eine hebt mahnend den Kopf. Othmar Schmiderer interessiert sich für Tiere. Mit dem Wissen um die unvermeidbare „Vermenschlichung“ der Tiere durch unseren Blick bleiben sie für ihn trotzdem ein Faszinosum, dem er – gemeinsam mit Regisseurin Angela Summereder – einen ganzen Film gewidmet hat, nämlich „Im Augenblick. Die Historie und das Offene“ (2012/13). Auch in weiteren Filmen des Regisseurs kommen Herdentiere vor und immer wieder ist die Sorgfalt, mit denen er sich ihnen widmet, augenfällig.
Sorgfalt, Beobachtung, Faszination, Offenlegung von Zuschreibungen sowie deren Brechung durch prononcierte filmästhetische Konzepte: Das sind die Pole, zwischen denen sich Schmiderers Arbeiten aufspannen. Ein ethnographisches Interesse ohne vermeintlichen Objektivismus prägt seine Dokumentarfilme. Er entdeckt das Fremde im Vertrauten und das Gewohnte im Fremden; zeichnet dieses auf und macht es somit erfahr- und erlebbar, egal ob es sich dabei um eine Ziegenherde in Oberösterreich oder um eines seiner Künstlerporträts handelt.
Geboren 1954 in Lofer/Salzburg, nun hauptsächlich in Grafenwörth lebend, beginnt er als Produktions- und Regieassistent beim Theater. Ab 1983 verlagert er diese Arbeit in den Filmbereich, zuerst als Assistent von Größen wie Valie Export und Michäl Pilz, dann als Kameramann und Tonmeister, schließlich als Regisseur eigener Projekte. Vielleicht stammt aus dieser Zeit auch sein Interesse an Kollaboration mit Künstlerinnen und Künstlern. So etwa mit dem Regisseur Harald Friedl, mit dem er gemeinsam die frühe essayistische Arbeit „mobile stabile“ (1992) über den Kulturraum Autobahn dreht.
Den Text dazu steuert der Schriftsteller Bodo Hell bei, mit dem Schmiderer noch in zwei weiteren Filmen zusammenarbeiten wird. „Am Stein“ (1995) ist einer davon und legt den Grundstein für eine Reihe an Arbeiten, die sich mit dem „Themenkomplex Mensch, Tier, Arbeit, Sinn“ (Schmiderer) auseinandersetzen. Darin folgt der Regisseur der Almbewirtschaftung im südlichen Dachsteingebiet, wobei er den Schafen, Ziegen und Kühen ebenso viel, wenn nicht sogar mehr Platz einräumt als den menschlichen Protagonistinnen und Protagonisten.
Dass dies nicht in eine romantisch-verklärende Idylle kippt, ist der kritisch-analytischen Herangehensweise des „embedded filmmakers“ zu verdanken: Er beobachtet und findet jeweils einen Modus, um die unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsweisen in seine Filmsprache zu übersetzen. Im Konzept zu „Die Tage wie das Jahr“ (2018) über eine biologische Landwirtschaft im Waldviertel, das er mit seiner langjährigen kreativen Partnerin Angela Summereder erarbeitet hat, geht es darum, „die Konsequenz des Handelns im alltäglichen Rhythmus der Arbeit, im Jahreszyklus als Bewegungsfolge mit einer eigenen visuellen Grammatik und im Rhythmus getakteter Wiederholungen in eine Filmsprache zu übersetzen“, so Schmiderer.
In seinem wohl bekanntesten und mehrfach preisgekrönten Film „Im toten Winkel – Hitlers Sekretärin“, 2001 in Zusammenarbeit mit André Heller entstanden, zeigt sich diese konzeptuelle Strategie am radikalsten. Schmiderer und Heller lassen Traudl Junge, Sekretärin Adolf Hitlers, von ihrem Werdegang und vor allem von den letzten Stunden vor der Kapitulation im Führerbunker fast ohne Nachfragen erzählen. Meist in der gleichen halbnahen Einstellungsgröße sehen (und hören!) wir sie beim Zeugnis-Ablegen wie auch beim Urteil über ihre eigene Darstellung sowie beim Korrigieren ihrer Erinnerungen. Ohne Kommentar und mit der „rauhen“ Atmo des Originaltones entzieht sich der Film jeglicher Sensationslust. „Ein Film zum Zuschauen und zum Zuhören, spektakulär ohne special effects“, heißt es dazu an anderer Stelle. Dies könnte generell für Othmar Schmiderers Filme stehen.
Die Jury gratuliert Othmar Schmiderer herzlich zum Würdigungspreis für Filmkunst des Landes Niederösterreich 2024 und damit einem Regisseur, der das genaue Zusehen und Zuhören als kritisch-politischen Modus seiner künstlerischen Arbeit versteht.
Claudia Slanar