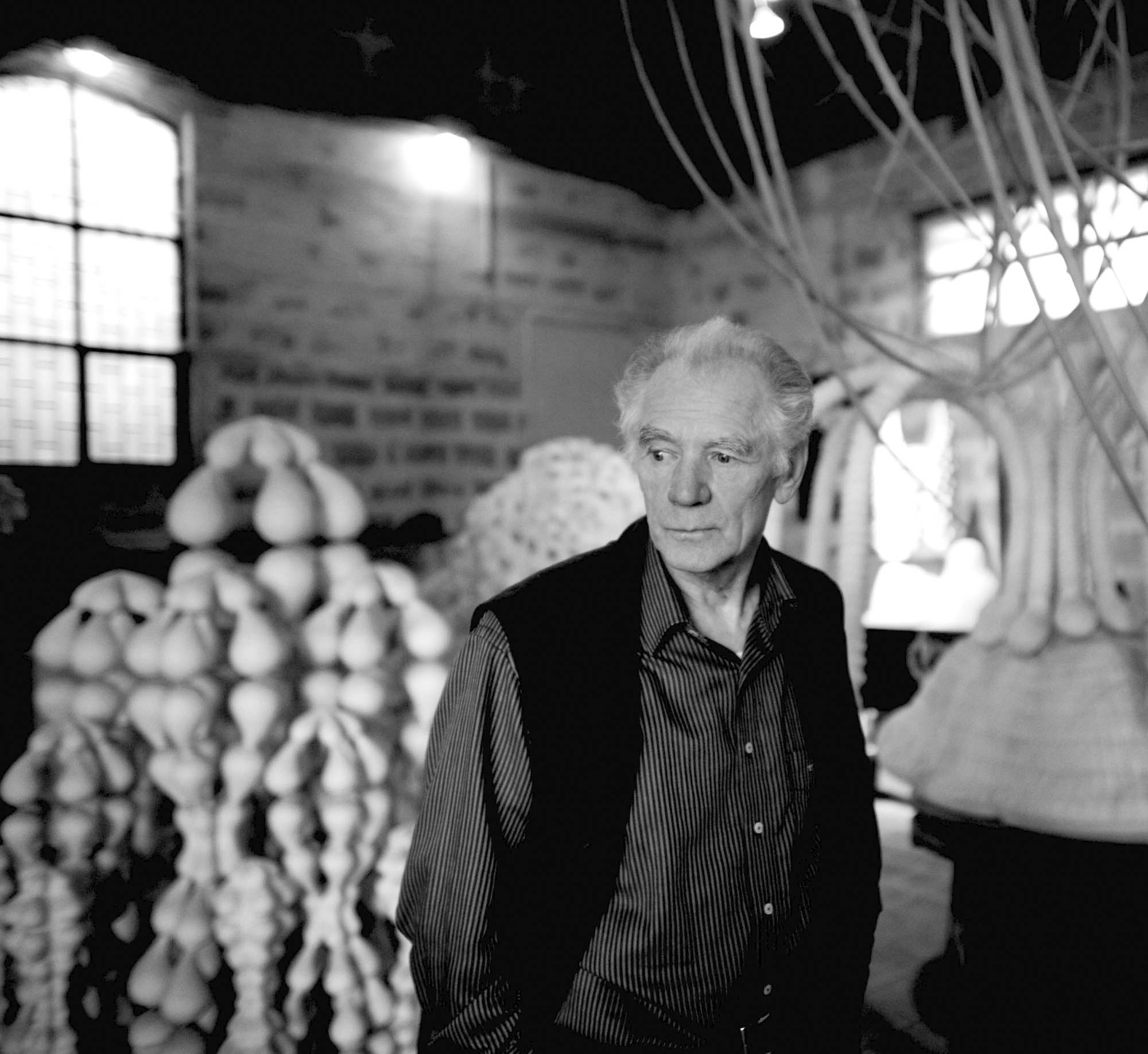Der Waldviertler
1971 begann Otto Breicha seinen einführenden Text im Katalog zur Ausstellung des Künstlers in der Galerie Würthle mit den Worten: «Ölzant heißt Franz Xaver wie der alte Messerschmidt», um damit das zu diesem Zeitpunkt noch kleine Œuvre des jungen Bildhauers bewusst an das große Potential österreichischer Skulptur heranzurücken und dem jungen Künstler einiges auf den Weg mitzugeben. Ausgewandert, so Breicha weiter, wären sie schließlich alle beide, der eine nach Pressburg, der andere ins Waldviertel, wo Ölzant von 1958 bis 1965 in Pfaffenschlag lebte und nach längeren Jahren in Wien, 1976 wieder dorthin zurückkehren sollte. Niederösterreich ist seine Wahlheimat geworden, und besonders seine Arbeit mit Findlingen ist mit dem Waldviertel eng verwoben und verbunden.
So treffend der Vergleich gewählt ist, soll dennoch nicht übersehen werden, dass Ölzant, der nun als großer Niederösterreicher gefeiert wird, von Geburt her Steirer ist. Zwischendurch war und ist er auch Wahlwiener. Mit 21 Jahren begann er ein Studium bei Knesl an der Universität für angewandte Kunst am Stubenring. Im Jahr davor besuchte er Florenz, um wesentliche Eindrücke von den Medici-Gräbern zu erhalten. 1958 schloss er sein Studium ab, um gleich darauf im Waldviertel allein, und zunächst ohne den Bezugspunkt des Kunstbetriebs im Auge zu haben, zu arbeiten. Schon damals verwiesen seine elementaren Gestaltungsprinzipien immer wieder auf die Natur, ohne sie jedoch nachzuahmen. Vielmehr verarbeitet er ihre Prinzipien in biomorphen Formen, die ebenso wie Pflanzen scheinbar im Wachstum begriffen sind und etwas von deren Lebendigkeit in sich tragen.
1965 hatte Ölzant seine erste Einzelausstellung im Wiener Künstlerhaus. Erstmals konnte er im größeren Rahmen zeigen, dass er einen anderen Weg eingeschlagen hatte als Wotruba, in dessen Werk er zu viel «Klassizistisches, Zurückschauendes» (Ölzant) wahrnahm. Ölzant befasste sich im Gegenteil mit Fragen wie Abstrahierung oder Schwerelosigkeit und sprach von einem Konzept von Skulptur, in dem ein Vorgang des Entmaterialisierens traditionelle Formen in eine neue Mikrostruktur umarbeitete. Viele Ausstellungen sollten auf diese erste wichtige Präsentation folgen, ebenso wie in den folgenden Jahren große Werkgruppen entstanden, die immer wieder die großen Wechselbezüge von Natur und Gestaltung, von Natur und Ornament aufnahmen. Es waren gerade Ornamentalisierung und Stilisierung, die ihn bewogen, «vom individualistischen Denken abzugehen» (Ölzant). Seine Erkenntnisse konnte der Künstler auch in Bildhauersymposien umsetzen. Darüber hinaus erhielt er öffentliche Aufträge, wie etwa im neuen Landhaus in St. Pölten. 1986 wurde er Professor an der Akademie der bildenden Künste Wien und Leiter einer Meisterklasse.
Sein großes ornamentales Empfinden ist auch in den «niederösterreichischsten» seiner Werke, den Findlingen, deutlich, die er in enger Anlehnung an die Natur weiterverarbeitet. Diese konsequente Weiterführung eigener Ideen im Wechselbezug zur Natur steht im Einklang mit der charakteristischen Landschaft des Waldviertels, deren geologische Gegebenheiten Ölzant als Grundlagen seiner Arbeit aufnimmt und weiterentwickelt. In seiner großen Arbeit «Basilika» von 1994, die nahe Waidhofen/Thaya in der Landschaft installiert ist, kann sich der Besucher einen Eindruck verschaffen, wie hier die Assoziation zu einer fünfschiffigen Kirche umgesetzt ist. In sechs gekrümmten Reihen, die sich aus Dioritfindlingen zusammensetzen, legt Ölzant seine Kirche an, die viel von der «Strahlkraft» (Ölzant) in sich hat, um die es dem Künstler geht. Plastik bedeutete für ihn ein unerhörtes Erlebnis und ein Inszenieren solcher Erlebnisumstände und -möglichkeiten: «Dass es immer wieder Formationen gibt, die in mir ein ganz intensives, spannungsvolles Erleben auslösen, gleichgültig ob es der Mensch ist oder die Natur, die das bewirkt haben …» (Ölzant).