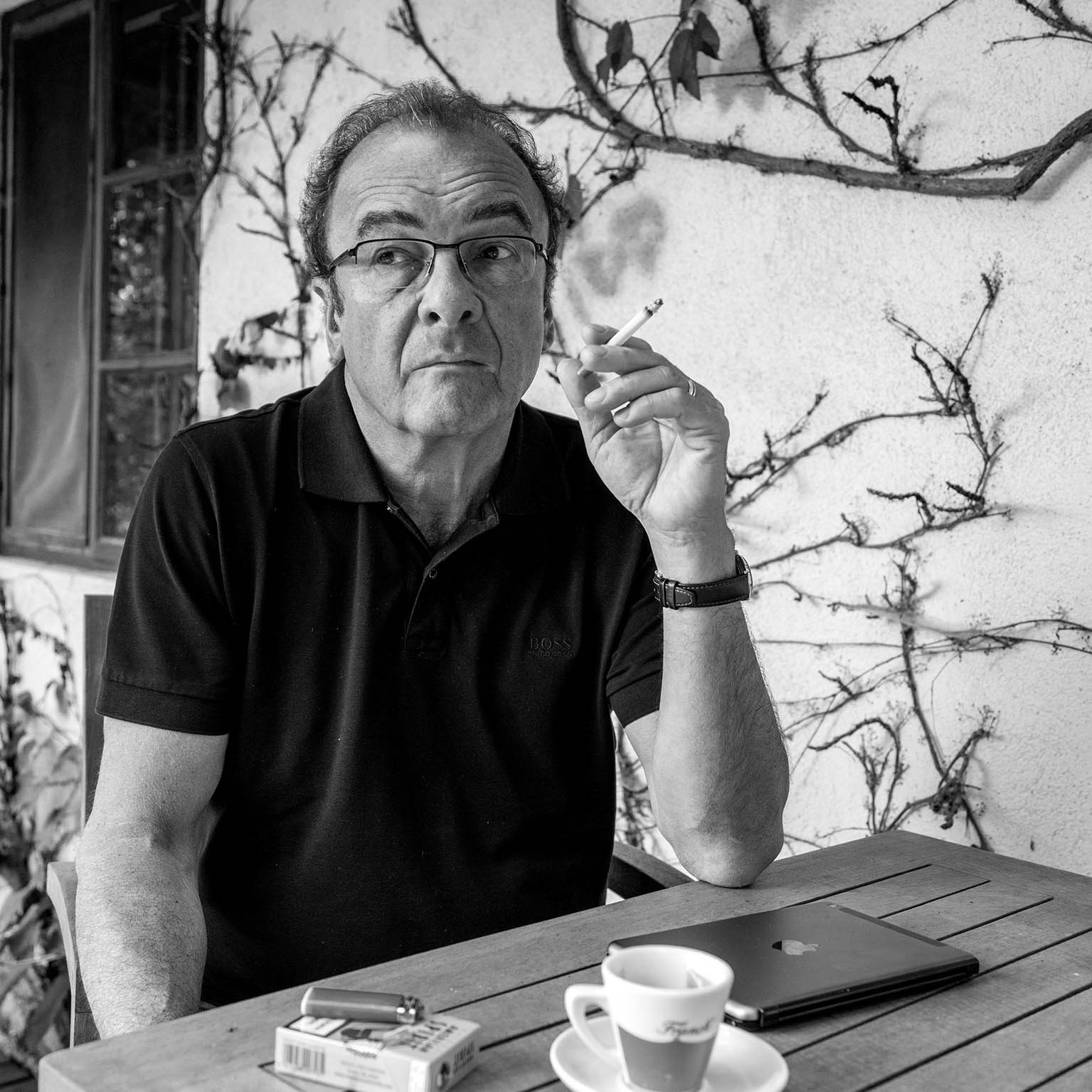«… eine Geschichte erzählen»
So lautete einst Robert Menasses Antwort auf die Frage, worum es ihm beim Schreiben gehe. Und tatsächlich ist in dieser vermeintlich simplen Antwort viel über den, auch nach eigener Aussage, «begnadeten Erzähler» Menasse gesagt. Seine Erzähllust ist die Basis seiner Arbeit, und sie ist, schon gemessen am Inhalt seiner literarischen Bücher, schier grenzenlos: In seinen bisher fünf Romanen spielt er mit nahezu allen bekannten Genres, holt denkbar weit aus – in menschliche Abgründe, die europäische Geschichte der letzten Jahrhunderte, Philosophie und Literatur, aber auch in seine Lebenswelten vom Waldviertel bis Brasilien – und erzählt vom Denken und Diskutieren seiner Figuren genauso lustvoll wie von deren Reisen und erotischen Nöten. Die Spanne zwischen Menasses erstem, 1991 erschienenen Roman «Sinnliche Gewißheit» und dem bislang letzten, «Don Juan de la Mancha» aus dem Jahr 2010, ist beträchtlich und beeindruckend. Und doch sind all diese Bücher im Verständnis des Autors, wie Menasse selbst es ausgedrückt hat, nur einige wenige von unendlich vielen Teilen der «einen einzigen Geschichte – die aber niemand erzählen kann, weil keiner imstande ist, alles zu wissen, alles zu überblicken und zu beherrschen». «Aber es ist noch nicht alles erzählt», lässt er seinen Erzähler am Schluss seines ersten Romans «Sinnliche Gewissheit» sagen.
Im Laufe der Arbeit an der großen, allumfassenden Geschichte wächst auch Menasses literarisches Werk aus «kleinen» Geschichten und mit ihm zwangsläufig die Erkenntnis, das Wissen um die erzählte, die verstandene Welt. Nicht nur mit seinen Romanen hat sich Menasse als eine der prominentesten und wichtigsten Stimmen innerhalb der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur etabliert. Ebenso berühmt ist er für seine Essays. Schon sein erster, der 1990 erschiene Essayband «Die sozialpartnerschaftliche Ästhetik», sorgte für Furore. Und mit dem Titel schuf Menasse einen fixen, in den verschiedensten Zusammenhängen immer wieder zitierten Begriff für die vielfältigen Vernetzungen und Abhängigkeiten im österreichischen Literaturbetrieb. Die österreichische Gegenwartsliteratur, den späteren Rahmen seiner Arbeit, hatte Menasse u. a. an der Wiener Universität studiert. Handelte seine Dissertation noch von den «Außenseitern» des Betriebs, namentlich von Hermann Schürrer, so bewegte er sich mehr und mehr hin zu den großen, zentralen Themen, nicht mehr nur der Literatur, sondern bis hin zur Europäischen Union und ihrer Schaltstelle, der Brüsseler Bürokratie, der er sich sozusagen über den Umweg und die Niederungen der österreichischen Identität und Politik annäherte.
Menasses Essays wurden und werden oft als provokant verstanden, heftig diskutiert und von vielen Seiten angefeindet. Als politischer Kommentator hat sich Menasse, glaubt man Daniela Strigl, «ohne Ansehen der Partei, mit allen angelegt». Doch im Grunde geht es Robert Menasse zunächst um etwas anderes, wie er in «Der europäische Landbote», seinem bislang letzten Essayband, schreibt: «Ich will meine Beobachtungen und das, was ich davon ableite, bloß zur Diskussion stellen. Ich beharre nicht darauf, ich kenne die Einwände, ich habe sie selbst!» Auch Provokation dient also der Erkenntnis: «Ich habe eine fixe Idee, und das ist, pathetisch gesagt, die Welt zu verstehen», sagt Menasse und stellt auf dem Weg zu diesem letztlich zwangsläufig imaginären Ziel eine Reihe von Fragen, ohne sich anzumaßen, die Antworten zu kennen.
Wer Geschichten erzählt, Offenlegungen provoziert, gibt immer auch Erfahrungen, Erwartungen, Hoffnungen weiter, stellt sie zur Diskussion, öffnet sich dem Dialog – und setzt sich Widerständen aus. Ein Autor im Menasse’schen Sinn ist somit kein Seher, kein Wegweiser, sondern besser als andere imstande, Fragen zu stellen. Und er tut dies auf eine besondere Weise, wie er am Schluss seiner Eröffnungsrede zur Frankfurter Buchmesse 1995 sagte:«Was wir Autoren tun können, ist schreiben. Unser Schreiben ist ein lautes Singen in finsteren Wäldern.»